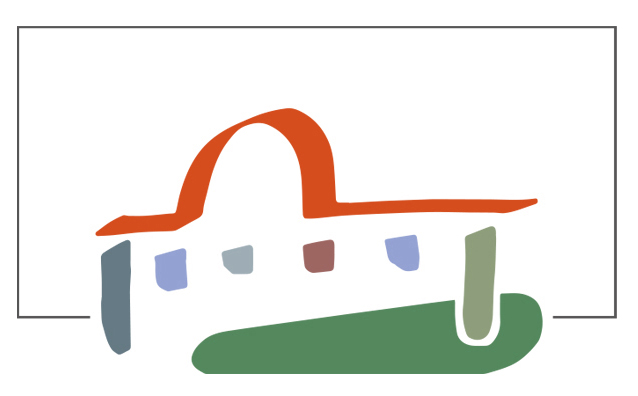AG – SCHREIBWETTBEWERB
Thema 2015: Stadtleben
Platz 1
STADTKINDER von Luca Schnepp-Pesch
Ich bin schon sehr alt und doch an manchen Stellen sehr jung. Ich bin mächtig und doch machtlos. Ich wurde im Jahre 1624 geboren. Ich war der Zeuge von Kriegsverhandlungen. Ich erlebte die Unabhängigkeitsbewegung mit. Ich ging fast an Epidemien zu Grunde. Ich habe gesehen, wie die Flapper in Flüsterkneipen tanzten. Ich habe gespürt, wie die Börse zusammenbrach und war Zeuge menschenverachtender Kriege. In mir tobten Rassenunruhen und Korruption. Mehrfach rettete mich der Wirtschaftsaufschwung. Ich erwachte aus einem düsteren Traum und blühte viele Jahre auf. Mitten in meiner Blüte wurde ich erneut erschüttert, man nahm mir einen Teil. Es schmerzt mich immer noch. Ich bin vernarbt. Doch ich lebe, ich bin ein Gigant, ich bin die Stadt, die niemals schläft, die neue Chancen gibt, die zusammenführt und trennt, ich bin New York City.
Ich habe die Macht über den Wind und das Wasser in meiner Stadt. Denn ich bin der Wind und das Wasser in meiner Stadt, weil ich die Stadt bin. Ich sehe euch durch jedes Fenster, jeden eurer Schritte fange ich auf. Jeder Geburt wohne ich bei, jeden begleite ich bei seinem Tod. Doch ich sehe euch nur zu, ich wehe nur durch Streets und Avenues, ich fließe nur um Manhattan herum. Nur spüren kann ich euch alle. Ich kann euch nur zuhören. Ich heiße euch nur willkommen und wünsche euch einen guten Heimweg. Ich kann euch nicht ändern, ich kann euch nicht sagen, was ihr tun sollt. Meine Stimme sind die hupenden Taxis, der Lärm der Masse und die Musik. Alles, was ich kann, ist zu versuchen, euch zu leiten und euch Signale zu senden. Ich sorge für euch, so wie ihr für mich.
Momentan gilt meine Sorge einem Mädchen, seit Tagen beobachte ich sie, sie sitzt in ihrem Hotelzimmer und geht nicht vor die Tür. Sie starrt die Wand an und weint hin und wieder. Abends schaltet sie den Fernseher an und wieder aus. Alle paar Stunden schaut ein Bediensteter des Hotels vorbei und bringt ihr Essen, in dem sie dann herumstochert. Das ist im Service des Hotels enthalten, denn die Leute, die dort absteigen, haben meistens keine Zeit, sich um ihr Essen oder Ähnliches zu kümmern. Sie sind beschäftigt, haben Auftritte oder wichtige Meetings. Doch das Mädchen nicht. Sie ist nur traurig und allein. Ich fühle mit ihr und höre mir ihre Gedanken an. Doch das spürt sie nicht. Also werde ich versuchen, ihr zu helfen. Sie sitzt schon viel zu lange herum. Gerade hat sie das Fenster geöffnet. Auf ihrem Bett liegen ein paar Dinge. Ein Lippenstift, ein Handy, ein Portemonnaie und eine Jeansjacke, auf deren Etikett ihr Name steht, sie heißt Ruby. Auf dem Schild steht auch noch ihre Handynummer. Es ist nur zu ihrem Besten, was ich jetzt tun werde. Ich wehe sturmartig in ihr Zimmer hinein, die Jacke reiße ich an mich und ziehe sie mit großer Mühe mit aus dem Fenster. Sie ist schwerer als ich gedacht hatte. Ich trage sie mühevoll über die vollen Straßen und lasse sie im Innenhof vom Laden eines jungen Mannes fallen, den ich ebenfalls schon eine Weile sorgenvoll beobachte. Ich weiß, dass sein Name Finn ist, ich habe zugehört, als seine Mutter ihm diesen Namen gab. Ich mag Finn, er ist sehr freundlich zu den Menschen, die ihn umgeben. Er bringt viele Leute zum Lachen, doch das Leben spielt ihm übel mit. Er hat schon seit vielen Jahren keine Eltern mehr, ich habe seine Mutter und seinen Vater aus der Stadt hinaus begleitet. Ich trug sie hoch hinaus, dann nahm der Himmel sie mir aus den Händen. Hin und wieder besucht ihn sein Bruder, ich heiße ihn immer wieder willkommen, doch er bleibt nie lange. Er schaut bei seinem Bruder rein, sie gehen etwas zusammen trinken und dann lässt sein Bruder sich ohne Finn in das tiefe Meer der Vergnügungen fallen. Er ist dann wieder allein in seinem kleinen Laden und hält Rechnungen über Rechnungen in den Händen. Er seufzt und fährt sich durch die Haare, dann stapelt er die Papiere unter dem Tresen und schließt den Laden. So vergehen die Wochen und mittlerweile ist der Stapel unter dem Tresen zu hoch gewachsen, heute ist der Tag der Zwangsräumung. Er sitzt jetzt im Innenhof seines leer geräumten Ladens und eine Jeansjacke fällt plötzlich vor ihm auf den Boden. Er schreckt zurück, verständlich, ich lasse nicht oft Jeansjacken über die Stadt fliegen. Er zieht etwas verwirrt die Augenbrauen hoch und wischt sich dann verstohlen über die Augen, doch ich bin der Einzige, der seine Tränen sieht und vor mir braucht er sich nun wirklich nicht zu schämen. Jetzt greift er nach der Jeansjacke und hebt sie auf. Er mustert sie und seine Augenbrauen wandern noch ein Stück höher, als sein Blick auf den Zettel fällt, wo der Markenschriftzug prangt. Erst danach bemerkt er den Zettel mit Namen und Telefonnummer von Ruby. Er ist einer der wenigen Menschen, bei denen ich weiß, dass er die Jacke nicht verkaufen wird. Er ist sehr aufrichtig, das ist eine Eigenschaft, die ich sehr an ihm schätze. Sie ist fast ausgestorben hier, die Gier verschlingt sie mit hungrigem Rachen. Jetzt zieht Finn sein Handy aus der Tasche seines Trenchcoats und sieht auf den Zettel in der Jeansjacke, zögernd tippt er die Nummer ein. Er scheint keine große Lust zu haben, jetzt mit irgendwem zu sprechen. Ich verstehe ihn, dennoch weiß ich, dass es gut für ihn sein wird. Finn hält sich das Handy nun ans Ohr, bei Ruby im Hotelzimmer ertönt die Melodie eines bekannten Pop-Hits aus ihrem Handy. Sie wirft dem Handy einen absolut lustlosen Blick zu, sie sieht auf das Display. Offensichtlich erscheint nicht der Name des Anrufers, bei dem sie nicht abnehmen würde, denn sie schluckt nur, räuspert sich und nimmt ab. „Hallo, hier spricht Ruby Daynes, mit wem spreche ich?“, fragt Ruby in das Gerät. „Ehm, mein Name ist Finn. Finn Castell, ich habe, also vor mir ist grade Ihre Jacke auf dem Boden gelandet.“ Finn lacht etwas nervös, es scheint ihm offenbar unangenehm zu sein. „Oh“, Ruby streicht sich ihre braunen Locken hinters Ohr und kratzt sich an der Schläfe. „Schön, dass Sie mich anrufen. Das ist nett. Soll ich sie abholen?“ Finn überlegt kurz und meint dann: „Ja, also wenn es Ihnen nichts ausmacht.“ Ruby wirft einen Blick in den Spiegel, der an der Wand hängt und betrachtet sich kritisch. „Ja das geht schon. Wo soll ich denn hinkommen?“ Finn guckt ratlos aus dem Tor des Innenhofs auf die Straße in Downtown. Sein Blick fällt auf den Abgang zur U-Bahn Station gegenüber. „Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Jacke beim Aufgang der Station Canal Street übergeben. Also falls das okay ist.“ „Ja, das passt, ich muss nur noch, ehm, duschen, ich kann in ca. einer Stunde, vielleicht etwas später, dort sein.“ Sie steht von ihrem Bett auf und geht schon in Richtung Badezimmer. „Okay, ich bin der Typ im Trenchcoat mit der großen Brille.“ Jetzt muss Ruby doch kurz grinsen über diese Beschreibung. „Alles klar, ich bin die mit den braunen Locken und den roten Stiefeln.“ Finns Mundwinkel fangen auch an zu zucken und er sagt: „Ich werde dich sicher erkennen, bis dann.“ „Bis dann!“, erwidert Ruby, legt auf und lässt das Wasser an. Sie steht unter der Dusche und wäscht sich Tränen von vielen Tagen ab, sie wirkt keinesfalls strahlend, das habe ich auch nicht erwartet. Doch man sieht, dass die Trauer und Hoffnungslosigkeit sie etwas locker gelassen haben. Sie irrt nicht mehr durch das Labyrinth ihrer eigenen Gedanken. Jetzt hat sie ein Ziel vor Augen, etwas, das ihr die Richtung weist, ich bin mir sicher, dass Finn ihr endgültig den Ausgang aus dem Labyrinth zeigen wird. Finn hingegen braucht jetzt jemanden, der ihn gar nicht erst in dieses Labyrinth fallen lässt, jemanden, der ihn vor der Finsternis der Hoffnungslosigkeit bewahrt. Momentan ist er in seiner kleinen Wohnung, nur ein paar Ecken von seinem geschlossenen Laden entfernt. Nachdem er sein Radio angeschaltet hat, schält er sich aus seinen Klamotten und setzt die große Brille ab. Jetzt spritzt er sich etwas Wasser ins Gesicht, seufzt und hält schließlich seine dunklen kurzen Haare doch noch unter den Wasserhahn und schüttelt sich dann, sodass das Wasser den Spiegel über dem Waschbecken nass spritzt. Energisch wischt er mit einem Handtuch darüber und rubbelt sich daraufhin damit durch die Haare. Er schiebt sich die Brille zurück auf die Nase und bewegt sich tanzend zu der Musik in Richtung seines Kleiderschranks, er tanzt immer nur, wenn er allein ist. Das ist sein kleines Geheimnis, das er nur mit mir teilt. Er ist kein großer Tänzer, doch es macht ihm Spaß, sich zu den Klängen aus dem Radio zu bewegen. Die letzten Tage, vor der Zwangsräumung, da hat er kein einziges Mal getanzt, ich freue mich, ihm endlich wieder dabei zuzusehen. Er zieht eine ausgeblichene Jeans hervor, streift sie sich über, klemmt ein paar Hosenträger dran und lässt sie lässig baumeln. Jetzt ist er auf der Suche nach einem frischen T-Shirt. Er wühlt im Schrank, bringt alles durcheinander, zieht ein blaues raus und wirft es wieder rein, zieht ein schwarzes raus und wirft es auf den Boden. Schlussendlich findet er dann ein altes, verwaschenes, graues Langarmshirt. Zur Krönung des Outfits setzt er sich noch einen dunklen Hut auf die mittlerweile trockenen Haare und wirft einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Er nickt, schlüpft in ein paar ausgelatschte blaue Herrenschuhe und zieht sich seinen Trenchcoat über. Ruby schminkt sich währenddessen, sie wählt einen dunklen Lippenstift, der wunderbar zu ihrem Jeanskleid und den roten Schuhen passt. Ihr frisch gewaschenes Haar lässt sie einfach offen, so verströmt es den Pfirsichduft ihres Shampoos. Ruby liebt den Geruch von Früchten, schon von klein auf hatte sie es geliebt, wenn ihre Mutter frisches Obst vom Markt mitbrachte. Sie mochte die knalligen Farben und den Geschmack von Obst. Doch am meisten genoss sie den Geruch. Daran hatte sich nichts geändert. Ihr Vater hingegen hatte ihr immer nur Geld geschickt. Immer hatte sie zu ihrer Mutter gesagt, dass das Geld nach grau stinken würde. Ihre Mutter hatte gelacht und gemeint, dass das Geld nichts dafür könne. Beim Gedanken an ihre Mutter muss Ruby sich zusammenreißen. Sie muss jetzt tapfer sein, sie kann sich nicht ewig verstecken. Nach dem Tod ihrer Mutter hat ihr Vater sie mit nach New York genommen und mit den Worten: „Hier kümmern sie sich um dich! Ich muss verreisen und mich um das Geschäftliche kümmern. Das Geld wächst ja nicht an den Bäumen“ in einem der teuersten Hotels in New York einquartiert. Hier war sie geblieben, umgeben von dem grauen Geruch des ganzen Hotels hatte sie hier gesessen und getrauert. Doch jetzt musste endlich Schluss sein, der Anruf hatte ihr neuen Mut gegeben. Sie würde jetzt rausgehen und weiterleben. Mit diesem Gedanken verließ sie das Hotelzimmer und ging endlich raus in die anonyme Stadt, die so roch, als würde man alles auf einmal riechen. Sie weiß es nicht, aber ich begleite Ruby die Straße entlang zur nächsten U-Bahn Station. Ihre Schritte sind federleicht und wirken etwas hoffnungsvoll. Schritte sind für mich wie ein Händedruck für die Menschen. An Schritten kann ich alles spüren, Schritte können furchtbar schnell oder quälend langsam sein, sie können freudig, aber auch schwer von Trauer sein. Sie sind manchmal lustlos und gelangweilt oder aber auch so geladen, dass sie mich fast nicht zu berühren scheinen.
Finn läuft freundlich und stetig, manchmal, wie jetzt, meine ich sogar zu spüren, dass er gerne tanzen würde. Ich freue mich über seine Art zu laufen, er läuft schon immer so, er läuft stetig als ein Teil von mir, als ein Teil von New York City. Er gehört zu mir, ich bin seine Heimat, er ist ein winziger Teil meines Herzschlags. Bei Ruby fühlt es sich anders an, ich freue mich auch über ihre Schritte, doch sie fühlt sich eher an wie das Bewegen eines Fingers. Ohne Finger kann ich nicht leben, ich brauche sie, ich mag sie. Doch ich spüre sie nicht so leibhaftig, wie ich mein Herz spüre. Ruby ist ein Finger, da ich nicht ihre Heimat bin. Doch ich spüre sie auch und so spüre ich ebenfalls, wie Ruby jetzt in die U-Bahn steigt und die U-Bahn, wie ein winziger Atemzug, losfährt. Sie sitzt in der U-Bahn und beobachtet die Leute um sie herum, sie haben alle eine Geschichte. Jeder ist genauso der Zentralpunkt ihres eigenen Lebens. Sowie Ruby von ihrem. Diesen Gedanken hat Ruby oft, sie liebt es, sich zu überlegen, wer diese Personen wohl sind. In dem Mann ihr gegenüber sieht sie einen Trainer, jemanden, vor dem die Leute Respekt haben. Einen Mann, der so begeisterungsfähig wie konsequent ist. Das macht sie an seinem durchdringenden, klaren Blick fest. Die Frau neben ihm ist für sie eine gestresste Karrierefrau. Der strenge Dutt, die unter Schminke fast gänzlich versteckten Augenringe und der Aktenkoffer verraten ihr das. An ihrer Seite sitzt ein mürrisches Schulmädchen. Ruby sieht, dass sie es hasst, hier in der Schuluniform rumsitzen zu müssen. Sie hat den ganzen Schulrock mit Stecknadeln durchbohrt und in ihren Kniestrümpfen sind Löcher. Auch ihren Blazer hat sie nicht verschont, sie hat ein einziges Wort hineingestickt: Black. Ruby hat jetzt das Gefühl, als würde sie die Personen ein wenig kennen. Jetzt fühlt sie sich nicht mehr ganz so allein in der U-Bahn. Während sie den anderen Personen in der U-Bahn auch eine Geschichte verleiht, saust der Zug weiter in Richtung der Station, an deren Ausgang Finn schon wartet. Er ist viel zu früh und er weiß es. Trotzdem sieht er ständig auf sein Handydisplay und muss jedes Mal erneut feststellen, dass die Zeit davon auch nicht schneller vergeht. Er mustert die Auslage der Boutique, dort liegen teure Anzüge und Lederjacken aus. Es wirkt alles sehr edel und gediegen, trotzdem wirft er einen Blick auf das Preisschild der einen Lederjacke, es bestätigt ihn nur, dass er sie sich niemals wird leisten können. Er läuft zurück zum Eingang der Station und schaut auf das Display, gleich müsste Ruby da sein.
Tatsächlich verlässt Ruby in diesem Moment die U-Bahn, in Gedanken wünscht sie den Menschen aus ihrem Wagon eine gute Weiterfahrt. Erst jetzt wird sie ein wenig nervös, sie fragt sich, wer Finn wohl ist und wie er aussieht, natürlich abgesehen von der Brille und dem Trenchcoat. Sie läuft an einem Musikanten in der Station vorbei und wirft ihm zwei Dollar in den Hut. Er nickt ihr zu und grinst, ihm fehlt ein Zahn. Ruby grinst freundlich zurück und läuft jetzt die Treppe zum Ausgang hoch. Da steht er, denkt sie, er hat sie noch nicht gesehen. Er sieht gut aus, sie beißt sich auf die Lippe und läuft absichtlich langsam die Treppe hoch, in der Hoffnung, dass er sie sieht. Und wirklich, er schaut die Treppe runter und erblickt sie. Er verschluckt sich fast, das hatte er nicht erwartet. Sie ist sehr hübsch und natürlich. Er weiß nicht, wo er mit seinen Armen hin soll, es muss ja wohl total daneben aussehen, wie sie da an ihm hinunterhängen. Wenn ich lachen könnte, würde ich das jetzt wohl tun, denn Finn sieht einfach nur ganz normal aus, wie er dasteht. Ruby würde sich jetzt gerne nochmal durch die Haare streichen, sie hat das Gefühl, dass sie zerzaust sind. Auch das stimmt nicht. Ich freue mich, denn ich habe das sichere Gefühl, dass mein Plan aufgehen wird. Doch ich kann für nichts garantieren, alles Weitere liegt in Finns und Rubys Händen. Ab diesem Punkt halte ich mich heraus, jetzt ist das Schicksal an der Reihe, ich habe mein Bestes gegeben. Ich besuche jetzt meine anderen Sorgenkinder, denn ich schlafe niemals, ich bin New York City!
Anmerkung: Diese Erzählung wurde ebenfalls von der Gedok Karlsruhe ausgezeichnet und gewann den JuLi-Prosapreis – herzlichen Glückwunsch!
Platz 2
REISE IN DIE ZUKUNFT – ODER (VIELLEICHT): WARUM KARLSRUHE GENAU HIER IST von Lucie Meinecke
Es tat einen Schlag und der Wagen erbebte. Ich wurde kräftig durchgeschüttelt, was bei meinem ohnehin schon angeschlagenen Steißbein ziemlich wehtat. Es hatte auf dem ganzen Weg schon viele Schlaglöcher gegeben. Eigentlich sollte ich das als Markgraf von Baden- Durlach nicht hinnehmen, aber im Moment regierte erst eine Vormundschaft um meine Großmutter Magdalene Wilhelmine für mich. Schließlich war ich erst zwölf, aber nach dem Tod meines Vaters 1732 und meines Großvaters 1738, also seit zwei Jahren, war ich amtlich gesehen Markgraf. page5image21000 page5image21160
Jetzt reiste ich nach Karlsruhe, in die Stadt, die mein Großvater Karl Wilhelm III. vor 25 Jahren gegründet hatte. Es war keine große Stadt, nur etwa 2500 Einwohner. Mein Großvater hatte aber schon früh Leute aus umliegenden Dörfern mit Baufläche und freiem Baumaterial hergelockt, was die Einwohnerzahl schnell ansteigen ließ.
Aber trotz vieler Bewohner war Karlsruhe noch in den Anfängen. Die Häuser waren einfach, und das einzige größere Gebäude war das Residenzschloss, das mein Großvater hatte erbauen lassen. Die Straßen waren meist einfache Feldwege und nicht unbedingt in bestem Zustand. Eben wie diese Verbindungsstraße nach Karlsburg, dem Ort, in dem ich und meine Großmutter lebten. Wenn ich endlich regieren durfte, würde ich zuerst die Straßen ausbessern lassen.
„Das linke Hinterrad ist gebrochen!“, rief der Kutscher und riss mich damit aus meinen Gedanken. Das Schlagloch hatte dem Wagen wohl den Rest gegeben. Ruckartig hielt er an. „Oh nein“, seufzte meine Großmutter und erhob sich, „Komm, Karl, die Wiese dort drüben sieht ganz nett aus.“ Ein Diener hielt uns die Tür auf und machte sich dann daran, den Wagen hochzustemmen, damit der Kutscher das kaputte Rad austauschen konnte.
Ich stieg aus und rieb mir das schmerzende Steißbein. Gegen solche Straßen hatten selbst die weichen Samtpolster keine Chance. Großmutter hatte bereits ihr Taschentuch unter einer alten Eiche am Wegesrand ausgebreitet und beobachtete, an den knorrigen Stamm gelehnt, den Kutscher.
Ich setzte mich zu ihr und sie meinte: „Das kann noch eine Weile dauern. Dann brauchen wir aber nicht mehr lange bis zum Schloss deines Großvaters.“ „Was ist es für eine Schloss?“, fragte ich. „Seit Großvaters Beerdigung waren wir nicht mehr dort. Und auch so habe ich es nie erkunden können.“ Großmutter schwieg einen Moment. Dann begann sie zu erzählen: „Es ist ein schönes Schloss, im Barockstil gebaut. Dein Großvater hat von Anfang an eine klare Vorstellung davon gehabt, wie es aussehen sollte. Er sagte immer, er habe es aus einem Traum nachbauen lassen... So sieht es auch aus, es hat viele Besonderheiten. Zum Beispiel den Turm, der nur durch offene Holzgalerien mit dem Hauptgebäude verbunden ist. Er ist etwa 170 Fuß hoch und hat sieben Stöcke. Dein Großvater saß oft oben und sah dem Treiben in seiner immerzu wachsenden Stadt zu.“ Sie schwieg eine Weile, und ich zog es vor, sie vorerst nicht mit weiteren Fragen zu stören.
Dann meinte sie: „Bei diesem Besuch wirst du viel Zeit haben, das gesamte Schloss zu erkunden. Die wirst du aber auch brauchen. Nicht einmal ich kenne alle Räume, erst recht nicht den Garten. Er ist riesig, voller geheimer Ruheoasen, in denen dein Großvater Tee zu trinken pflegte.“
Eine Weile saßen wir schweigend da und ich dachte über die Worte meiner Großmutter nach. Ich bewunderte sie sehr. Sie war eine feine Adelsdame, das merkte man schon daran, wie sie ihre Worte wählte. Sie sprach sehr viel mit mir, und sie wusste unglaublich viel. In meiner Erziehung war sie so streng, wie es sich gehörte. Aber sie hörte mir immer zu, wenn ich erzählte, was mir auf der Seele brannte. Eigentlich sollte ich mit meinen Gedanken und Problemen selbst klar kommen, aber mich beschäftigte so viel. Die ganze Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die andere einfach so hinnahmen, Folter, Sklaverei und Armut. Aber ich würde das vielleicht teilweise ändern können, wenn ich denn endlich regieren durfte.
„Aufstehen, Karl, ich denke, der Kutscher ist fertig“, sagte meine Großmutter. Ich sprang auf und half ihr beim Aufstehen. Ihre alten Gelenke machten das nicht mehr so gut mit. Die weitere Fahrt verlief eher holprig, aber ohne weitere Zwischenfälle. Als wir endlich in Karlsruhe angekommen waren, war die Sonne schon fast untergegangen. Ich beobachtete gespannt die Menschen auf der Straße, wie sie geschäftig umhereilten. Wenn sie die Kutsche bemerkten, machten sie schnell Platz und verneigten sich. Als wir nach einiger Zeit am Schloss ankamen, staunte ich. Es war mir viel kleiner in Erinnerung gewesen.
Sobald wir hielten, sprang ich aus dem Wagen. Ein Diener geleitete mich und meine Großmutter zum Schloss, während einige andere Pagen unser Gepäck und die Pferde versorgten. Nachdem wir uns eine Weile in einem großen Raum ausgeruht und uns ordentliche Kleider angezogen hatten, begaben wir uns in den Speisesaal. Auf der langen Tafel waren köstliche Speisen aufgereiht. Mit langen Schritten kam Karl August auf uns zu, der Mann, der das Schloss im Moment verwaltete. Er begrüßte uns höflich, dann führte er uns zu unseren Plätzen. Während des Essens fragte er, was wir denn zu tun gedachten. Ich erklärte ihm, dass ich das Schloss erkunden würde. Daraufhin lächelte er und meinte: „Da wirst du wahrlich lange zu tun haben. Aber ich muss dich warnen. Einige Teile des Schlosses sind nicht mehr so gut in Stand, besonders die Fachwerkteile. Wir haben nun etwas wenig Geld...“, murmelte er verlegen. Nach dem Essen wurde ich in meinen Schlafsaal geleitet. Aber auch in dem großen Himmelbett konnte ich lange nicht schlafen und malte mir aus, was ich morgen wohl alles erleben würde.
Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Die ersten Sonnenstrahlen drangen zwischen den Zweigen hervor. Es würde ein wunderbarer Tag werden. Ich zog mich an und versuchte die knarrende Tür möglichst leise zu öffnen. Eine Magd bemerkte mich und brachte mich in dieKüche, wo sie mir einen Teller mit Brot, Schinken und Käse und einen Becher Milch reichte. „Eure Großmutter sagte bereits gestern, dass Ihr heute früh wach sein werdet. Ihr sollt spätestens zum Mittag wieder im Saal erscheinen.“ „Danke, mach ich!“, versicherte ich. Nachdem ich das Frühstück heruntergeschlungen hatte, machte ich mich auf den Weg. Ich lief durch einen langen Gang und kam auf den hinteren Hof. Dann machte ich einen großen Bogen um den Westflügel und gelangte zu den Pferdeställen. Nachdem ich nach unseren Pferden gesehen hatte, nahm ich eine Laterne von einem Haken an der Wand. Man konnte ja nie wissen, wo man so hinkam. Ich machte einen kurzen Rundgang durch die Beete, in denen mein Großvater gestorben war. Dann ging ich durch das Haupttor. Hier waren einige Knechte mit einem Eselskarren unterwegs. Ich schlängelte mich an ihnen vorbei und blieb in einem Vorraum stehen. Einer der beiden Knechte nahm einen Kartoffelsack auf die Schultern und ging auf eine kleinere Tür zu, offensichtlich der Zugang zum Keller. Ich folgte ihm kurzentschlossen und ging eine schmale, ausgetretene Treppe hinunter.
An einer Wandfackel entzündete ich meine Laterne und begab mich dann in den Lagerraum. In langen Reihen standen hier Kisten, Säcke und Fässer. Ich wollte mich gerade zum Gehen wenden, als ich im Augenwinkel einen Schatten wahrnahm. Ich schaute genauer hin. Tatsächlich, es war der Anfang eines schmalen Ganges, hinter einigen Kisten verborgen. Ich schob einige Säcke zur Seite und lief hin. Es war ein dunkler, enger Gang, und es roch modrig. Ich musste mich bücken, als ich ihn vorsichtig betrat. Der Gang machte einige Kurven und endete dann abrupt. Im schummrigen Schein der Lampe erkannte ich eine Tür aus dunklem Holz. Sie schien schon sehr alt und hatte eine reich verzierte Klinke, aber kein Schloss. Vorsichtig drückte ich die Klinke herunter und öffnete die Tür. Der Gang, den ich betrat, war viel größer als der, aus dem ich gekommen war. Die Wände waren seltsam grau und glatt, und es roch gar nicht mehr muffig. Nach einer Biegung stieg ich eine Treppe hinauf. Sie hatte ein Metallgeländer, das mit einem seltsamen grünen Material ummantelt war. Ich gelangte in einen großen Saal mit riesigen Fenstern. Der Boden war aus fein poliertem Marmor. Das hatte ich im ganzen Schloss noch nicht gesehen. Als ich aus dem Fenster sah, erblickte ich auf einmal riesige Gebäude. Sie waren ein großes Stück vom Schloss entfernt. Auf dieser Strecke lagen Tulpenbeete und Wasserbecken, die mit flachen Steinmauern eingefasst und von weißen Steinfiguren geziert waren. Überall liefen Menschen in bunter Kleidung herum, die auf irgendetwas in ihrer Hand starrten und riesige braune Taschen trugen. Auf einmal ertönte hinter mir eine laute Stimme. „He, was machst du denn noch hier?“ Ich zuckte zusammen und drehte mich um. Ein etwas dickerer Mann mit grüner Kleidung schaute mich verärgert an. „Ich, also...“, stammelte ich. Der Mann schnitt mir das Wort ab. „Hast dich wohl auf eine dieser beknackten Mutproben eingelassen. Wolltest dich im Museum einschließen lassen, was? Dachtest wohl, in diesem Fummel würden wir dich für ein Ausstellungsstück halten? Nicht mit mir, Bürschchen. Aber originalgetreu nachgebildet, das muss man dir lassen. Sieht fast wie echt aus. Bist dem jungen Karl Friedrich wie aus dem Gesicht geschnitten.“ Ich wollte gerade erwidern, dass ich doch Karl Friedrich war, aber der Mann stieß mich unsanft aus einer Tür, die er mir dann vor der Nase zuknallte. Offenbar hatte er mich für einen einfachen Burschen gehalten, der sich ins Schloss einschleichen wollte. Ich schaute mich verwirrt um. Welches Schloss eigentlich? Hier war ich noch nie gewesen. Das Schloss, das vor mir aufragte, ähnelte schemenhaft Großvaters Schloss. Auch den Turm erkannte ich wieder. Aber dieses Schloss war aus Stein, der irgendwie gelblich war. Die Fassade sah aus wie die, die ich kannte, aber es waren mehr und größere Fenster darin. Sie waren aus ganzen Platten und perfekt durchsichtig.
Nein, das war irgendwie nicht Großvaters Schloss. Was mir als Nächstes auffiel, war der Lärm. Es war ein Brummen, Dröhnen und Rauschen, kein Hufgeklapper war zu hören, keine Händler priesen laut schreiend ihre Ware an. Egal wo ich war, ich war auf keinen Fall dort, wo ich hergekommen war. Nachdem ich mich etwas gefasst hatte, lief ich in Richtung der Menschen, die ich vom Fenster aus gesehen hatte. Je näher ich kam, desto mehr wunderte ich mich über sie. Manche hatten Hemden an, die gar nicht über den Bauch gingen. Aber irgendwie war es hier auch wärmer. Auch die Farben der Kleidung waren seltsam, sie leuchteten grellbunt und es waren teilweise komische Formen mit glitzerndem Material darauf gestickt. Was mich aber am meisten wunderte, war, dass die Mädchen und Frauen soweit ich sehen konnte nur Hosen trugen. Ich ging auf zwei Jungen zu, die auf dünnen Brettern mit kleinen bunten Rädern standen und sich ab und an mit den Füßen ein Stück voran schoben. Sie hatten weiße Schnüre in ihren Ohren stecken. Ich fragte: „Entschuldigt vielmals, aber wo bin ich hier?“ Die Jungen lachten und riefen: „Was hast du denn für Klamotten an?“ „Was bitte?“, fragte ich verwirrt. „Läuft bei dir, Junge!“, schrie einer, dann schoben sie sich davon. „Was? Wo?“, fragte ich erschrocken und drehte mich einmal um mich selbst. Da lief nichts neben mir, was auch immer ein „Klamotten“ sein sollte.
Da sprach mich eine überraschend alte Frau an: „Sie meinen deine Kleider, Bub. Ich habe mir das auch von meinem Enkel erklären lassen müssen. Aber schön sind sie, deine Kleider. Spielst du wohl Theater?“ „Nein, eigentlich nicht“, meinte ich. „Gut“, sagte die alte Frau noch, dann stützte sie sich auf ein seltsames Fahrgestell auf vier Rädern und schob es davon. Ich lief in die gleiche Richtung die gepflasterte Straße entlang. Wo war ich hier nur? Und vor allem, wie kam ich wieder zurück? Nach etwa hundert Fuß erblickte ich einen eigenartigen Metallzaun, an dem bunt bemalte Stoffstücke hingen. Sie waren in großen Buchstaben beschriftet, die den mir bekannten bei genauerem Hinsehen sogar ziemlich ähnlich waren. Mit etwas Mühe entzifferte ich den verwirrenden und zugleich erschreckenden Satz: „Karlsruhe wird 300 Jahre alt – Wir sind dabei!“ Langsam sagte ich zu mir selbst: „Das bedeutet, dass ich zwar in Karlsruhe bin, aber im Jahr... 2015! Aber wie bin ich hierher gekommen? Und wie komme ich wieder weg?“
„Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber vielleicht kann ich dir irgendwie helfen?“, tönte auf einmal eine Stimme neben mir. Ich fuhr zusammen. Neben mir stand ein Junge, der etwa so groß wie ich war. „Ich bin Niklas“, stellte er sich vor und streckte mir die Hand entgegen. Ich schüttelte sie und sagte: „Gestatten, Karl Friedrich von Baden-Durlach.“ Vielleicht war es erst mal gut, ein wenig Eindruck zu schinden. Wobei ich bezweifelte, dass man mich in der Zukunft kannte. „Karl Friedrich? Im Ernst? Genau so hieß der, den wir gerade in Geschichte durchnehmen. Toller Typ, aber die Texte im Schulbuch über ihn sind voll langweilig. Nein, jetzt mal ehrlich, du kommst aus der Vergangenheit? Du willst mich echt nicht..., ich meine ... du willst mir keinen Bären aufbinden?“, fragte der Junge. „Leider nicht“, bedauerte ich. „Kannst du mir sagen, was für ein Datum wir heute schreiben?“ „Den 30. April 2015“, antwortete Niklas. „Wie bist du denn hierher gekommen?“ „Durch eine Tür im Schloss“, erwiderte ich. „Das ist doch Karl Wilhelms Schloss?“, fragte ich. „Ja klar. Obwohl, das ursprüngliche Schloss wurde einmal teilweise neu aufgebaut und war dann nach irgendeinem Weltkrieg so zertrümmert, dass es komplett neu aufgebaut werden musste. Dabei wurde aber nur die äußere Fassade nachgebaut und der Innenraum wurde ein Museum. Der alte Grundriss ist kaum noch erhalten. Aber sag mal, warum gehst du nicht einfach zurück durch die Tür? Und außerdem dachte ich, du hast, äh lebst in Karlsburg?“, sagte Niklas. „Ein unfreundlicher Mann hat mich aus dem ... Museum geworfen. Er sagte irgendwas von einer Mutprobe und dass sie geknackt wäre. Und eigentlich machte ich gerade eine Reise mit meiner Großmutter nach Karlsruhe. Aber als ich das Schloss erkundete, ging ich durch eine Tür und gelangte in dieses Gebäude. Erst wusste ich überhaupt nicht, wo ich bin und wunderte mich über eigentlich alles. Aber dann warf mich der Mann raus und ich bin hierher gegangen. Ist es hier überall so?“, fragte ich. „Wie?“, wunderte sich Niklas. „So eben“, meinte ich und deutete auf die Menschen um uns herum. „Diese seltsamen flachen Steine, auf die sie die ganze Zeit starren und die sie mit ihren Fingern polieren zum Beispiel“, erklärte ich. „Oh, das ... , das sind Handys“, sagte Niklas. „Wenn sie mit dem Finger darüber wischen, können sie ... Botschaften von anderen lesen.“ „Sind sie Sklaven? Aber dann sollten sie doch eigentlich nicht lesen können“, wunderte ich mich. „Nein, sie sind keine Sklaven. Sie empfangen nur Nachrichten von ihren Freunden. Sklaverei gibt es heute gar nicht mehr. Und lesen kann hier jeder. Dafür bist du mitverantwortlich... gewesen“, erläuterte Niklas lächelnd. „Wirklich?“, freute ich mich. „Aber hier ist so vieles so ...fast unheimlich. Etwa diese riesigen orange-blauen Metallkästen, die sich bewegen und den Boden zerwühlen und dabei so schrecklichen Lärm verbreiten. Von was werden sie angetrieben, leben sie etwa?“ „Nein, nein, sie leben nicht. Das sind Bagger. Sie werden von Motoren angetrieben, aber die Menschen haben sie unter Kontrolle. Sie haben sie gebaut. Mit Baggern wird hier zum Beispiel die Straße erneuert. Das spart Schweiß und geht viel schneller als von Menschenhand.“ Ich musste trotz der schwierigen Situation fast lachen. Schließlich hatte ich mir noch vor kurzer Zeit gewünscht, dass die Straße erneuert wurde. Jetzt machte es mir fast Angst. „Na ja, egal was ist, wir müssen dich zurückbringen. Die Frage ist nur, wie wir das schaffen. Denn ins Museum zu kommen ist jetzt schwierig. Um 17 Uhr schließt das Museum, und jetzt ist 17:30 Uhr. Wir müssen es also morgen versuchen. Bis dahin musst du irgendwo bleiben, aber mit zu mir nach Hause kann ich dich nicht einfach nehmen. Vielleicht... ja, das ist eine gute Idee! Wir haben einen Gartenschuppen mit Übernachtungslager. In der Nacht wird es zwar eher kalt, aber mit einigen Decken müsste es gehen. Essen und Trinken können wir dir auf dem Weg besorgen. Bist du einverstanden?“, fragte Niklas. „Na ja, wenn es nicht anders geht. Hauptsache, ich komme bald zurück nach Karlsruhe, ich meine natürlich 1740“, antwortete ich. „Wo lebst du denn? Ist es weit von hier? Wie kommen wir denn dorthin? Ich sehe nirgendwo eine Kutsche.“ Ich drehte mich einmal um mich selbst. Dabei fiel mir auf, dass einige Leute mich ansahen. Bestimmt wegen der Dinge, die ich anhatte. Wahrscheinlich hielten sie sie ebenfalls für Klamotten. „Es ist etwa drei Kilometer von hier entfernt. Wir fahren mit der Straßenbahn dorthin“, erklärte Niklas. „Kilometer ist eine Maßeinheit heutzutage. Sie hat leichte Ähnlichkeit mit der Meile. Die Straßenbahn siehst du gleich.“ Er führte mich einige Zeit durch die Menge, bis wir vor dicken Metallstreifen im Boden stehen blieben. Hier schienen auch einige andere Menschen zu warten. Ein Großteil hatte Schnüre in den Ohren stecken. Auf einmal quietschte es fürchterlich und ein riesiges gelbschwarzes Etwas mit dunklen Glasfenstern wälzte sich auf uns zu. Es rauschte noch ein Stück an uns vorbei, bis es stehen blieb. Ich erschrak fürchterlich, aber da alle anderen ruhig blieben, dachte ich mir, es konnte ja nicht sehr gefährlich sein. Trotzdem zuckte ich zusammen, als sich unter lautem Paffen und Zischen an mehreren Stellen die Außenhaut des seltsamen Dings öffnete. Einige Leute stiegen heraus und Niklas zog mich zielstrebig in eine der Öffnungen hinein. Als wir drinnen waren, erkannte ich zu meinem Erstaunen weiche Sitze mit grüngelben Polstern. Niklas schob zweimal ein Stückchen Papier in einen gelben Kasten, der dabei ein lautes Piepsen von sich gab. Dann setzten wir uns auf zwei freie Plätze, gerade als das Ding sich ruckartig wieder in Bewegung setzte. „Das ist eine Straßenbahn“, sagte Niklas. „Jeder, der möchte, darf mitfahren, wenn er etwas bezahlt. Mit dieser Karte“, er hielt das Papierstück hoch, „beweist man, das man bezahlt hat. Gerade habe ich sie entwertet. Die Straßenbahn fährt durch die ganze Stadt, wobei sie an bestimmten Stellen hält. Man kann ein- und aussteigen, wann man möchte.“ Wir schwiegen eine Weile, und ich schaute aus dem Fenster. Nach einer Kurve, in der die Straßenbahn wieder laut quietschte, erblickte ich auf einmal lauter bunt gefärbte Metallkästen mit Fenstern, die über die schwarze, glatte Straße sausten. Sie hatten vier seitlich gelegene schwarze Räder und hinten ragte ein kurzes Metallrohr aus ihnen heraus. In jedem von ihnen saß vorne links jemand, der eine Art Steuerrad in den Händen hielt. „Sind das auch Straßenbahnen?“, fragte ich. „Sie fahren gar nicht auf Metallstreifen und sind viel kleiner.“ „Das sind Autos. Die meisten Erwachsenen hier haben so eines. Mit dem Lenkrad steuern sie es und wenn sie auf ein Pedal treten, fahren sie schneller. Autos brauchen keine Schienen, also diese Metallstreifen. Sie können einfach so auf der Straße fahren. Sie erleichtern uns die Fortbewegung sehr, aber jeden Tag sterben Menschen und Tiere, weil sie von Autos überfahren werden.“ Auf einmal ertönte eine laute, verzerrte Stimme, die so etwas Ähnliches wie „Damm am Stock“ sagte. „Wir müssen aussteigen“, sagte Niklas und zog mich zur Tür.
Als wir einige Zeit später einen kleinen eingezäunten Garten betraten, zeigte er mir ein kleineres Haus und sagte: „Hier wohne ich.“ Dann lief er ins Haus und kam nach einiger Zeit mit einer Decke und einem Teller mit Brot und Käse wieder. Er öffnete den Gartenschuppen und legte mir die Decke auf eine Matratze in einer Ecke. Dann reichte er mir den Teller und einen Becher, den er an einem Wasserhahn in der Wand gefüllt hatte. „Hier, bitte, wahrscheinlich ist das für einen Markgrafen viel zu wenig, aber mehr kann ich dir nicht bieten“, lächelte er. Dann setzten wir uns auf die Matratze und er erzählte mir einiges von seiner Schule. Doch es wurde schnell dunkel und nach einiger Zeit meinte er, seine Eltern wären bestimmt schon von der Arbeit zurück und er ging ins Haus, nachdem er mir eine gute und hoffentlich warme Nacht gewünscht hatte.
Am nächsten Morgen weckten mich die ersten Sonnenstrahlen und ein zaghaft an die Tür klopfender Niklas. Ich stand auf und klopfte mir einige Krümel vom Hemd. Ich hatte die Nacht nicht gut geschlafen, weil ich noch lange über die Dinge nachdenken musste, die ich am Tag zuvor gesehen hatte. Über diese seltsamen Sitten und Straßenbahnen, Autos und wie sie noch alle hießen. Und vor allem darüber, dass das hier nicht mehr im Entferntesten das Karlsruhe war, das ich kannte. Ich öffnete die Tür des Schuppens. Niklas hatte einen Teller mit Frühstück und eine Jacke von sich dabei. „Die solltest du anziehen, damit du wegen deiner Kleider nicht so auffällst“, meinte er. Ich fragte etwas verwirrt: „Wann gehen wir denn? Ich dachte, du musst zur Schule?“ „Ich habe gesagt, ich hätte Halsschmerzen und wurde beim Lehrer entschuldigt. Das macht Mutter sofort. Das Museum macht um zehn Uhr auf, jetzt ist halb neun. In einer halben Stunde sollten wir los.“ Diese Zeit ging schnell vorbei und mit etwas Geld für den Eintritt machten wir uns auf den Weg. Nach einer Dreiviertelstunde und einer weiteren Fahrt mit der Straßenbahn standen wir endlich vor dem Schloss. „Wer ist das?“, fragte ich und zeigte auf eine Statue in einem flachen Wasserbecken. „Das bist du“, lachte Niklas. Weil noch eine Viertelstunde bis zur Öffnung blieb, gingen wir eine Weile um das Schloss herum und ich erzählte Niklas, was hier früher gewesen war und wir überlegten uns, wie wir unbemerkt zu der Tür gelangen konnten. Sie befand sich ja im für Besucher unzugänglichen Keller. Dann, als endlich das Museum öffnete, traten wir als Erste ein. Niklas legte der Frau am Eingang das Geld hin und behauptete: „Wir haben schulfrei.“ Dann nahm er noch ein bunt beschriebenes, gefaltetes Blatt aus einem Regal und reichte es mir. „Ein kleiner Stadtführer mit aktuellem Stadtplan. Falls du Genaueres wissen willst.“
Nach einem kurzen Rundgang erkannte ich den Saal wieder, in dem ich den unfreundlichen Mann getroffen hatte. Es war zum Glück außer uns niemand hier und wir fanden auch die Treppe wieder. Wir versicherten uns, das niemand uns sah und stiegen sie dann gemeinsam hinunter. Ich atmete auf, als ich die alte Tür sah. Aber irgendwie war mir auch mulmig zumute. Was, wenn ich irgendwo in der Zeit verschollen bleibe? Aber ich beruhigte mich und wendete mich zu Niklas. Ich sah ihn einen Moment schweigend an, dann sagte ich: „Ohne dich würde ich wohl nie zurückkommen und mich jämmerlich verirren in dieser Welt voller Autos, Bagger und Klamotten. Ich danke dir, mein Freund.“ Dann zog ich aus dem Stoff meines Hemdes vorsichtig die goldene Brosche mit meinen Initialen und reichte sie ihm. Er nahm sie überrascht an und meinte: „Das hätte es gar nicht gebraucht. Für mich war es toll genug, zu erfahren, wie es früher wirklich war und dir zu helfen.“ Dann streckte er mir die Hand entgegen und ich schüttelte sie. „Auf Wiedersehen. Oder eher nicht“ sagte er. Er steckte die Hand in die Hosentasche und gab mir ein Papierstück, auf dem er zu sehen war. „Ein Foto. Eine Erfindung von heute. Dinge werden von einem Apparat genau so abgebildet, wie sie sind.“ Ich steckte das Ding ein und schüttelte noch einmal seine Hand. Dann drehte ich mich um und ging durch die Tür.
Ich war noch nie so froh gewesen, muffige Kellerluft zu riechen. Die Laterne stand noch genau dort, wo ich sie hatte stehen lassen. Doch sie brannte noch. Als wäre ich nie weg gewesen. Als ich mich nach ihr bückte, fiel mir eine Nische in der Wand auf, in der irgendetwas lag. Ich holte es heraus. Es war ein kleines schwarzes Notizbuch, das ziemlich alt aussah. Ich schlug es auf und entzifferte mühsam eine schmierige Handschrift: „Ich erfuhr aus Aufzeichnungen meines Großvaters, dass sich in der Nähe Durlachs ein Hügel befindet, in den vor langer Zeit ein Gang gegraben wurde. An seinem Ende befindet sich eine Holztür. Aus mündlich weitergegebenen Geschichten hatte er erfahren, dass sie sich etwa alle 100 Jahre öffnen lässt und dann für einige Zeit einen Zugang in andere Zeiten freigibt. Doch ihm glaubte niemand, selbst als er im Jahre 1640 selbst in die Zukunft reiste, wohl in das Jahr 1834. Ich glaube es aber, obwohl ich mich davon wohl nie selbst überzeugen kann. Zum Schutze dieser Tür gedenke ich auf diesem Hügel ein Schloss zu bauen und dort meine Stadt zu gründen. 12. April 1714, Karl Wilhelm“.
Platz 3
GROßSTADT von Franca Lau
Jenna: Ich schaue aus dem Fenster, draußen zieht die Welt an mir vorbei. Dann setze ich die Kopfhörer auf. Musik an; Welt aus. Das ist es, was ich jetzt brauche. Wenn ich Musik höre, verschwinden all meine Probleme für einen kurzen Moment und ich kann voll abschalten, eine angenehme Pause von dem ganzen Stress. Aber diesmal ist es anders, diesmal klappt es nicht so ganz. Das Problem verschwindet nicht, es ist immer noch da. Könnte daran liegen das ich direkt darauf zu fahre, denn das Problem heißt Stadt.
Es fing vor ein paar Monaten an. Eigentlich lebe ich auf dem Land und ehrlich gesagt liebe ich es dort. Ich liebe die frische, reine Luft und die Natur, die grünen Wiesen, die Wälder, den klaren Sternenhimmel und das Vogelgezwitscher. Ich liebe die Geräusche der Tier, die immer wieder die Ruhe durchbrechen und dennoch nicht stören. Ich liebe mein Dorf und dass jeder dort jeden kennt. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich dort niemals weggegangen.
Allerdings ging es nicht nach mir. Es war ein Samstag, schönstes Wetter, total klare Luft, eigentlich ein wunderschöner Tag - bis zu dem Moment, in dem meine Eltern in mein Zimmer kamen. Sie setzten sich nebeneinander vor mich, so als müssten sie mir etwas Dringendes mitteilen. Und dann sagten sie: „Wir ziehen um... in die Stadt. Dein Vater hat dort einen Job bekommen...“. Sie erzählten noch mehr, aber ich hörte ihnen gar nicht mehr zu. Mir schwirrte nur dieser eine Satz im Kopf herum. „Wir ziehen um... in die Stadt.“ In dem Moment zerbrach für mich eine kleine Welt. Es war nicht so, dass ich noch nie in der Stadt gewesen wäre und es war auch nicht so, dass ich die Stadt total hasste. Aber ich mochte sie nur als Reiseziel. Ein paar Tage in die Stadt, in den Trubel und dann wieder nach Hause, erkennen, was man am Land hat. Für mich war die Stadt groß und bedrohlich, ein Ungeheuer, auf das ich direkt drauf zu fuhr. Und ich konnte nichts dagegen machen.
Schließlich sind wir auf der Autobahn. Je näher wir unserem Ziel kommen, desto mehr holt die Realität mich ein und desto wütender und verzweifelter werde ich. Bis vor kurzem habe ich noch geglaubt, dass das alles nur ein Traum ist. Ich habe mit der Hoffnung gelebt, dass sich die ganze Situation noch wie von Zauberhand ändern würde.
Jetzt wird mir klar, wie dumm das war.
Und dann sind wir da. Ich steige aus dem Auto. Wir befinden uns in einer Wohngegend voller Mehrfamilienhäuser. Sie wird durchkreuzt von vielen Straßen und für einen Moment frage ich mich, wie diese Gegend wohl von oben aussieht, doch dann verliere ich diesen Gedanken wieder, weil mir klar wird, dass ich von nun an hier wohnen werde.
Hier, in einem Haus mit vielen anderen Familien, die ich alle nicht kenne, nicht kennen will. Hier, an einer lauten Straße, auf der im Sekundentakt Autos vorbeifahren.
Hier, wo die Luft nicht klar und rein ist. Hier, wo die einzige Grünfläche ein kleiner Park ist, in dem massenhaft kleine kreischende Kinder spielen. Und in dem Moment weiß ich, dass ich es hier hassen werde.
Nick: Ich laufe durch die Straßen, um mich herum rennen die Leute, schubsen mich, rempeln mich an. Wenn ich Glück habe, bekommen ich ein kurzes „`tschuldigung“ zugemurmelt, doch im Normalfall laufen die Leute einfach weiter, ohne überhaupt zu bemerken, dass sie gerade jemanden angerempelt haben. Oder sie wollen es einfach nicht bemerken. Manchmal motzen sie auch mich an und geben mir die Schuld. Andere Menschen würden sich darüber sicher furchtbar aufregen, aber mir macht das nichts aus. Für mich gehört das irgendwie zur Stadt dazu. Es ist ein Teil von ihr. Und da ich diese Stadt liebe, muss ich auch diesen Teil akzeptieren. So ist das nun mal. Es ist halb sieben und die Straßen sind immer noch maßlos überfüllt. Auch das ist nichts Neues. Ich gehe an einigen Geschäften vorbei und schaue in die Schaufenster. Alles Mögliche gibt es dort zu sehen, meistens unwichtiger Kleinkram oder die neueste Mode. Eigentlich nichts, was man wirklich dringend braucht, doch die Plakate in den Schaufenstern werben mit Top- Angeboten und „super-günstigen-Preisen“. Und die Menschen fallen darauf rein und betreten in Massen die Geschäfte und Läden. Doch das ist okay. Ich verurteile sie nicht. Im Gegenteil: ich verstehe sie. Auch ich bin schon häufig auf diese Werbungen reingefallen und bisher habe ich es noch nie wirklich bereut, denn auch das gehört dazu. Auch das ist eines der vielen Dinge, die die Stadt ausmacht.
Ich beschließe, nach Hause zu gehen. Es ist ganz einfach. Ich werde von der Menschenmasse mitgezogen, mehr noch, ich werde selbst ein Teil von ihr. Ich verschwinde in der Anonymität der Großstadt. Niemand hier kennt mich und ich kenne niemanden. Und dennoch sind wir alle Teil einer einzigen Sache. Jeder ist verantwortlich, jeder ist wichtig, wie die Einzelteile einer Maschine. Jedes Zahnrad, jede Schraube, jedes noch so kleine Stück Blech ist wichtig, damit die Maschine läuft. Und diese Maschine hier heißt Stadtleben.
Irgendwann löse ich mich von der Menschenmasse und betrete eine Seitenstraße. Hier ist es im Vergleich zu den Hauptstraßen fast schon gespenstisch still. Wieder eine andere Seite der Stadt. Die Stadt ist vielfältig, sie hat eine Menge Gesichter. Ich laufe weiter durch die Straßen, biege hier und da ab, bis ich vor einem hohen Gebäude stehe. Mein Zuhause. Da, wo ich wohne. Wenn möglich, halte ich mich hier nicht auf. Es ist mir zu unbelebt und ungemütlich, zu trist und karg, zu einseitig.
Unsere Wohnung gefällt mir zwar, aber dennoch schlägt hier nicht zu hundert Prozent mein Herz. Mein Herz schlägt in der Stadt, in dem Trubel und dem Rummel, in dem Gewirr aus Menschen.
Jenna: Ich bin nun schon seit ein paar Tagen hier, doch gewöhnt habe ich mich nicht an das Leben in der Großstadt. Meinen Eltern zuliebe tue ich so als ob das der Fall wäre, doch in Wirklichkeit hasse ich es hier. Und ich vermisse so viel von zu Hause. Ich vermisse meine Freunde, ich vermisse das Land, die Natur, die Luft, die Tiere. All das sind Dinge die man hier in der Stadt so nicht vorfindet. Hier ist die Luft verpestet. Ich habe das Gefühl, dass ich bei jedem Atemzug allen Schmutz und alle Abgase dieser Welt einatme und von der wirklich reinen Natur kann hier kaum die Rede sein. Ein paar Bäume hier und da, damit die Luft, die ich atme, vielleicht ein bisschen sauberer wird. Ich weiß, ich höre mich vermutlich total pingelig an, wie ein Ökofreak, aber das bin ich nicht. Mir fallen nur diese enorm großen Unterschiede auf, und je mehr Unterschiede mir auffallen, desto überzeugter bin ich, dass ich hier nicht leben möchte.
Ich sitze in der Straßenbahn auf dem Weg in die Stadt. Nachdem meine Eltern bemerkt hatten, dass ich mich hier nicht sehr wohl fühle und den ganzen Tag nur zu Hause in unserer Wohnung sitze, meinten sie, ich solle doch mal in die Stadt gehen, shoppen, so wie das hier alle anderen Jugendlichen auch machen. Ich habe eingewilligt. Zum Teil weil ich weiß, dass ich mich früher oder später daran gewöhnen muss, zum Teil aber auch, weil ich meine Eltern nicht verletzen möchte. Ich sehe doch, dass es ihnen auch schwer fällt, vor allem meiner Mutter. Und ich sehe, dass es auch für sie eine Umstellung ist und dass auch sie das Land vermissen.
Der Unterschied ist nur, sie hatten die Wahl, sie konnten aus freien Zügen entscheiden, ob sie auf dem Land bleiben oder in der Stadt leben wollen. Ich konnte das nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich musste mit und konnte nichts dagegen machen, dennoch verzichte ich darauf ihnen all diese Vorwürfe an den Kopf zu werfen.
Ich schaue aus dem Fenster der Bahn, die Kopfhörer auf den Ohren. Das erinnert mich nur zu sehr an den Tag unserer Anreise. Doch diesmal zieht nicht die Landschaft an mir vorbei, sondern die Stadt mit all ihren Facetten. Ich sehe hässliche Neubauwohnungen mit ihren tristen, grauen Außenwänden. Ein Balkon stapelt sich über dem nächsten. Es scheint so, als würden diese Gebäude bis in den Himmel wachsen. Natürlich weiß ich, dass das nicht so ist, aber trotzdem. Als ich diese kargen schmucklosen Gebäude sehe, in denen sich eine Wohnung an die nächste reiht, bin ich froh, dass ich wenigstens in einer schönen Gegend wohne.
Und an so einer Gegend fahre ich auch jetzt vorbei. Wirklich schöne Altbauwohnungen mit reich verzierten Fassaden und schönen Erkerfenstern reihen sich aneinander. Und ich gebe zu, diese Gebäude sind wirklich schön, doch mir ist hier alles viel zu eng. Die Gebäude stehen alle so gedrängt, möglichst jede Fläche wird für
Wohnraum genutzt. Und auch wenn es zwischen den ganzen hässlichen Hochhäusern immer wieder schöne Altbauten gibt, so ist auch dieser ständige Wechsel irgendwann anstrengend. Die Straßenbahn hält, hier muss ich aussteigen. Die Türen öffnen sich und ich steige aus und werde sofort von dem Monster verschluckt.
Das Monster ist nicht wirklich ein Monster. Das Monster ist die Menschenmasse, das Getümmel. Ich habe kaum einen Fuß aus der Bahn gesetzt, schon werde ich von dem Strom mitgerissen. Anfangs versuche ich noch dagegen anzukämpfen, doch dann sehe ich ein, dass es zwecklos ist. Ich habe das Gefühl zu versinken. Immer wieder werde ich mitgerissen, verliere die Orientierung. Es ist wie die reißende Strömung eines Wildwasserflusses, nur dass dieser Fluss aus Menschen besteht. Ich tauche unter, werde von einem Strudel mitgerissen, tauche kurz auf, nur um dann erneut unterzugehen. Ich werde panisch. Endlich schaffe ich es, mich in eine Seitenstraße zu retten. Ich lehne mich an eine Wand, atme ein paarmal tief durch, bis meine Panik verebbt. Dann gehe ich wieder zur Hauptstraße, nehme all meinen Mut zusammen, atme einmal tief ein und betrete dann erneut das Getümmel. Diesmal weiß ich, was auf mich zukommt. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich schaffe es, mir einen eigenen Weg durch die Massen zu bahnen und stelle fest, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich bei meinem ersten Versuch gedacht hatte. Dennoch werde ich andauernd von Leuten angerempelt, doch sie laufen einfach weiter, drehen sich nicht einmal um. Als wäre ich gar nicht da, als würde ich nicht existieren.
Nick: Ich laufe das Treppenhaus herunter. Ich komme an einigen Wohnungstüren vorbei. Ich denke daran, dass sich hinter jeder dieser Türen ein anderes Leben abspielt. Dieser Gedanke fasziniert mich. Wer weiß, was die Familie, die dort hinter dieser Tür wohnt, wohl gerade macht? Vielleicht gab es gerade Mittagessen und die Kinder spielen nun. Vielleicht wohnt dort auch gar keine Familie, sondern eine junge Frau, die gar keine Zeit für Mittagessen hat, weil sie für ihr Studium lernen muss. Hinter jeder Tür befindet sich eine eigene kleine Welt, ein eigenes kleines Universum. Menschen mit eigenem Bewusstsein und eigener Wahrnehmung, einer anderen als meiner. Jetzt bin ich unten angekommen. Ich verlasse das Haus und betrete die Straße. Hier ist es ruhig, hin und wieder rennen ein paar Menschen an mir vorbei. Sie beachten mich gar nicht, bemerken mich vermutlich nicht einmal. Ich mag das. Hier kann ich ich selbst sein, hier interessiert sich niemand für mich, einen Jugendlichen, der einfach nur da ist. Ich laufe weiter. Je näher ich der Innenstadt komme, desto voller wird es. Schließlich habe ich keine Lust mehr. Ich beschließe, die Straßenbahn zu nehmen. Ich gehe zu der nächsten Haltestelle und schaue auf die Anzeigetafel. Die nächste Bahn kommt in zwei Minuten. Perfekt. Ich setze mich auf die Bank und warte. Ich schaue mich um. Um mich herum stehen viele Menschen, alle sind mit sich selbst beschäftigt. Dann folge ich mit den Augen den Schienen in die Richtung, aus der meine Bahn kommen wird. Im nächsten Moment sehe ich sie, wie sie langsam immer näher kommt, immer größer wird. Dann hält sie und öffnet ihre Türen. Ich steige ein, stemple meine Karte ab und suche mir dann einen Platz. Ich liebe es, mit der Straßenbahn zu fahren. In der Straßenbahn kann man Menschen am besten beobachten. Die meisten Leute sind nicht sehr spannend und eher unscheinbar. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass in fast jeder Bahn mindestens ein interessanter Mensch sitzt. Das kann jemand sein, der rein vom Äußerlichen interessant ist, es kann aber auch eine ältere Dame sein, die mit niemand Bestimmtem über ihr Leben redet. Wer auch immer es ist, es ist immer interessant. Es gibt auch Leute die immer wieder auftauchen, wie die Frau, die aussieht wie eine Zigeunerin und die alte Lieder vor sich hin singt. Diese Frau sehe ich auch jetzt. Sie kennt mich schon vom Sehen und lächelt mich kurz an, ich lächle zurück. Mehr haben wir uns noch nie miteinander beschäftigt. Wir haben noch nie ein Wort gewechselt und von mir aus kann es so auch bleiben. Da ich sie schon kenne, schaue ich mich weiter um, entdecke aber sonst niemanden. Also setze ich mich einfach hin und schaue aus dem Fenster. Da draußen zieht die Stadt an mir vorbei, doch ich nehme sie gar nicht wahr. Obwohl ich die Stadt liebe, ist es weniger die Stadt an sich, die mich interessiert, als die Menschen, die in ihr wohnen. Ich bin ein stiller Beobachter.
Schließlich hält die Bahn an und ich steige aus, betrete das Gewirr aus Menschen. Ich kämpfe mich durch die anonyme Masse. Das ist ganz einfach für mich. Schließlich bin ich schon so lange in der Stadt, dass ich darin mittlerweile geübt bin. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich lasse mich einfach treiben.
Das ist das Schöne, man weiß nie, wo man ankommt. Ich lande auf einem Platz. Um mich herum befinden sich lauter Geschäfte. Er ist voll mit Menschen, die mich alle nicht beachten. Doch plötzlich habe ich das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich schaue mich um und dann sehe ich sie. In meiner Nähe steht ein Mädchen. Sie ist ungefähr in meinem Alter. Sie ist hübsch, aber keine auffallende Schönheit, und ich frage mich, warum ich sie entdeckt habe. Sie sieht sehr unsicher aus, so als fühle sie sich hier überhaupt nicht wohl. Und dann wird es mir klar. Sie ist der erste Mensch der mich hier scheinbar bewusst wahrnimmt. Abgesehen von der Zigeunerin in der Straßenbahn.
Sie schaut mich direkt an und ich fühle mich dabei unwohl, beobachtet, irgendwie bloßgestellt, da ihr Blick so eindringlich ist. Ich hasse es, wenn Menschen mich so angucken. Ich bin gerne unsichtbar, aber dieses Mädchen scheint mich zu bemerken. Am liebsten würde ich mich jetzt umdrehen und einfach weggehen, doch stattdessen setzen sich meine Beine fast automatisch in Bewegung...
Jenna: Er stand da und schaute mich einfach nur an. Ich war gerade aus einem Geschäft gekommen, hatte versucht, das zu tun, was meine Eltern mir vorgeschlagen hatten: Shoppen. Doch es hatte nicht geklappt. Ich bin einfach in das erstbeste Geschäft gegangen. Zahlreiche Tische voll mit Waren warben mit günstigen Angeboten, und eine Schar von Menschen war auf der Suche nach einem Schnäppchen. Ich ging zu einem der Tische und nahm einfach halbherzig irgendein T-Shirt in die Hand. Im nächsten Moment wurde ich zur Seite geschubst und das Shirt fiel zu Boden. Ein paar fremde Hände griffen danach. Das war zu viel. Es war nicht so, dass ich den Verlust des T-Shirts bedauerte, ich hatte es mir nicht einmal wirklich angesehen, doch ich mochte es nicht, dass ich scheinbar Luft für die Menschen hier war. Niemand beachtete mich, sie alle waren einfach nur mit sich selbst beschäftigt.
Ich verließ das Geschäft eilig, ich fühlte mich einfach zu unwohl.
Und dann stand er da. Ich musste ihn aus irgendeinem Grund anschauen. Ich wusste nicht wieso. Irgendwie faszinierte er mich. Er schien meine Blicke zu bemerken, denn er drehte sich um und sah mich an. Ich war irgendwie erleichtert, denn es war das erste Mal, dass mich jemand zu bemerken schien. Es wirkte jedoch so, als würde er sich wegen meiner Blicke unwohl fühlen. Ich wollte mich gerade wegdrehen, als er plötzlich auf mich zuging.
Und dann steht er direkt vor mir. Er öffnet den Mund und schließt ihn dann wieder, so als wolle er was sagen, weiß aber nicht was. Es wirkt so, als wisse er gar nicht, warum er zu mir gekommen ist. Dann sagt er etwas.
„Hallo“ sagt er, „Hallo, ich heiße Nick.“ Dann macht er den Mund wieder zu und schaut mich einfach nur an, so als hätte er alles gesagt. „Jenna“, antworte ich. Erneut ist es eine Weile still, keiner von uns beiden sagt etwas. „Das ist ein schöner Name“, sagt er schließlich. Ich merke, wie ich sanft lächele. „Vielleicht“, denke ich, „vielleicht kann ich mich ja doch noch irgendwie an das alles gewöhnen.“